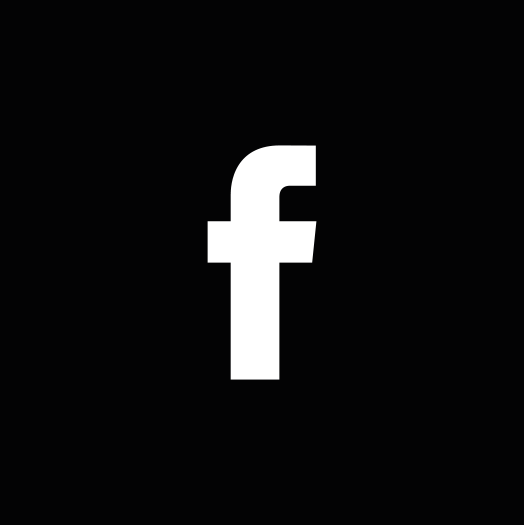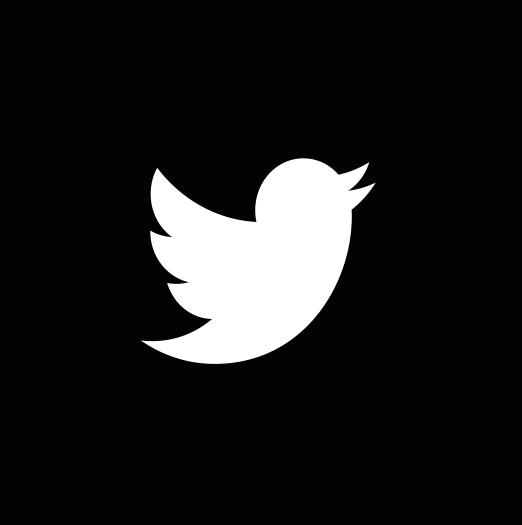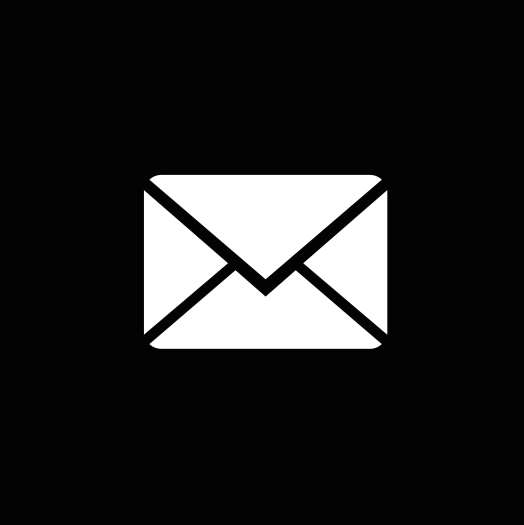https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/17-forensic-architecture/msf-01_small.jpg
MSF Supported Hospital, 2016, Video, 8:23 Min., Ton (Videostill) © Forensic Architecture / Courtesy Forensic Architecture
Forensic Architecture
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/17-forensic-architecture/msf-03_small.jpg
MSF Supported Hospital, 2016, Video, 8:23 Min., Ton (Videostill) © Forensic Architecture / Courtesy Forensic Architecture
Forensic Architecture
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/1-boris-becker/trisha_baga_loaf_0051_small.jpg
Oasis, 2016, 3D-Videoinstallation, 16 Min., Ton, Maße variabel (Foto: Uli Holz), © Trisha Baga / Courtesy Trisha Baga und Société, Berlin
Trisha Baga
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/cuthbert-bede-001_2.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Pen and Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/cuthbert-bede-002.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Pen and Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/cuthbert-bede-005.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Pen and Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/cuthbert-bede-008.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Penand Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/cuthbert-bede-009.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Pen and Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/cuthbert-bede-010.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Pen and Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/3-cuthbert-bede/nwphopl-bede-1855-book-scan.jpg
Photographic Pleasures, Popularly Portrayed with Pen and Pencil, London, 1855/64, 2 Bücher, 17 x 11 cm, 52 S., Sammlung Vesko Gösel / Privatsammlung Konstanz © Cuthbert Bede
Cuthbert Bede
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/5-natalie-bookchin/fp_03_my-meds-natalie-bookchin_small.jpg
My Meds, 2009, aus Testament, 2009-17, Video, 1:10 Min., Ton © Natalie Bookchin / Courtesy Natalie Bookchin
Natalie Bookchin
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/6-dirk-braeckman/27.1-21.7-045-2014_small.jpg
27.1 /21.7 / 045 / 2014, 2014, Inkjet-Print, 120 x 180 cm © Dirk Braeckman / Courtesy Galerie Thomas Fischer, Berlin / Zeno X Gallery, Antwerpen
Dirk Braeckman
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/9-peggy-buth/pb_fio_c_print_3_3.jpg
Finger it out! (Detail), 2008, C-Print, 54 x 41 cm © Peggy Buth / Courtesy Peggy Buth / KLEMM'S, Berlin
Peggy Buth
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/9-peggy-buth/plakat_finger_it_out-1.jpg
Finger it out! (Detail), 2008, Offsetdruck, 54 x 41 cm © Peggy Buth / Courtesy Peggy Buth / KLEMM'S, Berlin
Peggy Buth
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/11-sara-cwynar/cc_sara_cwynar_2013_girl-from-contact-sheet_small.jpg
Girl from Contact Sheet 2 (aus Darkroom Manuals, 2013), 2013, Chromogenic Print, 76,2 x 69,6 cm ©Sara Cwynar / Courtesy Sara Cwynar / COOPER COLE, Toronto, Canada
Sara Cwynar
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/11-sara-cwynar/lighting-test-woman_small.jpg
Lightning Test Woman (aus Darkroom Manuals, 2013), 2013, Chromogenic Prints, 76,2 x 69,6 cm © Sara Cwynar / Courtesy Sara Cwynar / COOPER COLE, Toronto, Canada
Sara Cwynar
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/11-sara-cwynar/metals-and-tanks_small.jpg
Metals and Tanks, (aus Darkroom Manuals, 2013), 2013, Chromogenic Prints, 76,2 x 69,6 cm © Sara Cwynar / Courtesy Sara Cwynar / COOPER COLE, Toronto, Canada
Sara Cwynar
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/11-sara-cwynar/total-exposure-control_small.jpg
Total Exposure Control, (aus Darkroom Manuals, 2013), 2013, Chromogenic Prints, 76,2 x 69,6 cm © Sara Cwynar / Courtesy Sara Cwynar / COOPER COLE, Toronto, Canada
Sara Cwynar
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/11-sara-cwynar/tree-in-nature_small.jpg
Tree in Nature, (aus Darkroom Manuals, 2013), 2013, Chromogenic Prints, 76,2 x 69,6 cm © Sara Cwynar / Courtesy Sara Cwynar / COOPER COLE, Toronto, Canada
Sara Cwynar
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/12-georges-demeny-etienne-jules-marey/dsc05477.jpg
Fencer in Forward Motion, um 1900, Silbergelatineabzug, 19,8 x 38,8 cm, Thomas Walter Collection
Georges Demenÿ & Étienne-Jules Marey
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/12-georges-demeny-etienne-jules-marey/dsc05478.jpg
Man on Exercise Bicycle, at Rest, um 1900, Silbergelatineabzug, 31 x 19,5 cm, Thomas Walter Collection
Georges Demenÿ & Étienne-Jules Marey
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/12-georges-demeny-etienne-jules-marey/dsc05480.jpg
Man on Exercise Bicycle, in Motion, um 1900, Silbergelatineabzug, 31 x 19,5 cm, Thomas Walter Collection
Georges Demenÿ & Étienne-Jules Marey
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/13-joseph-maria-eder/dr.josef-maria-eder-001-2.jpg
Husnik &Häusler, Illustration zum Dreifarbendruck, aus Joseph Maria Eder, Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1895, Buch, 18,5 x 13,5 cm, 636 S., Privatsammlung, Konstanz © Joseph Maria Eder
Joseph Maria Eder
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/13-joseph-maria-eder/dr.josef-maria-eder-002.jpg
Husnik &Häusler, Illustration zum Dreifarbendruck, aus Joseph Maria Eder, Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1895, Buch, 18,5 x 13,5 cm, 636 S., Privatsammlung, Konstanz © Joseph Maria Eder
Joseph Maria Eder
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/13-joseph-maria-eder/dr.josef-maria-eder-003.jpg
Husnik &Häusler, Illustration zum Dreifarbendruck, aus Joseph Maria Eder, Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1895, Buch, 18,5 x 13,5 cm, 636 S., Privatsammlung, Konstanz © Joseph Maria Eder
Joseph Maria Eder
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/13-joseph-maria-eder/dr.josef-maria-eder-004.jpg
Husnik &Häusler, Illustration zum Dreifarbendruck, aus Joseph Maria Eder, Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1895, Buch, 18,5 x 13,5 cm, 636 S., Privatsammlung, Konstanz © Joseph Maria Eder
Joseph Maria Eder
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/13-joseph-maria-eder/dr.josef-maria-eder-005.jpg
Husnik &Häusler, Illustration zum Dreifarbendruck, aus Joseph Maria Eder, Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1895, Buch, 18,5 x 13,5 cm, 636 S., Privatsammlung, Konstanz © Joseph Maria Eder
Joseph Maria Eder
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/14-olafur-eliasson/107d2295_2.jpg
Your Uncertain Shadow (Black and White), 2010, Halogenlamen, Glas, Aluminium, Transformatoren, Installationsansicht, Martin-Gropius-Bau, Berlin 2011, Foto: Maria del Pilar Garcia Ayensa / Studio Olafur Eliasson © Olafur Eliasson / Courtesy Olafur Eliasson / neugerriemschneider, Berlin
Olafur Eliasson
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/15-harun-farocki/unbenannt-11.jpg
Aufstellung, 2005, Film, 16 Min., (Regie, Buch:Harun Farocki / Idee, Recherche: Antje Ehmann / Recherche: Matthias Rajmann / mit Mitteln von TRANSIT MIGRATION, Kulturstiftung des Bundes / Produktion: Harun Farocki Filmproduktion, Berlin) © Harun Farocki, Harun Farocki GbR / Courtesy Harun Farocki GbR
Harun Farocki
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/15-harun-farocki/unbenannt-14.jpg
Aufstellung, 2005, Film, 16 Min., (Regie, Buch:Harun Farocki / Idee, Recherche: Antje Ehmann / Recherche: Matthias Rajmann / mit Mitteln von TRANSIT MIGRATION, Kulturstiftung des Bundes / Produktion: Harun Farocki Filmproduktion, Berlin) © Harun Farocki, Harun Farocki GbR / Courtesy Harun Farocki GbR
Harun Farocki
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/15-harun-farocki/unbenannt-24.jpg
Aufstellung, 2005, Film, 16 Min., (Regie, Buch:Harun Farocki / Idee, Recherche: Antje Ehmann / Recherche: Matthias Rajmann / mit Mitteln von TRANSIT MIGRATION, Kulturstiftung des Bundes / Produktion: Harun Farocki Filmproduktion, Berlin )© Harun Farocki, Harun Farocki GbR / Courtesy Harun Farocki GbR
Harun Farocki
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/15-harun-farocki/unbenannt-3.jpg
Aufstellung, 2005, Film, 16 Min., (Regie, Buch:Harun Farocki / Idee, Recherche: Antje Ehmann / Recherche: Matthias Rajmann / mit Mitteln von TRANSIT MIGRATION, Kulturstiftung des Bundes / Produktion: Harun Farocki Filmproduktion, Berlin) © Harun Farocki, Harun Farocki GbR / Courtesy Harun Farocki GbR
Harun Farocki
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/18-richard-frater/richard-frater-april_2.jpg
April, 2015/17, Modifizierter Greenpeace Standing-up-for-the-Earth-Kalender, sandgestrahltes Kamergehäuse, Edelstahlrohr, Canon EF 300mm f/2.8L © Richard Frater / Courtesy Richard Frater
Richard Frater
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/19-latoya-ruby-frazier/000-latoya-ruby-frazier-litho-1-statement_bd.jpg
Campaign for Braddock Hospital (Save Our Community Hospital), 2011, Portfolio mit 12 Prints, Fotolithographien und Siebdruck, 43 x 35,5 © LaToya Ruby Frazier / Michel Rein, Paris/Brussels / KADIST Collection, Paris
LaToya Ruby Frazier
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/19-latoya-ruby-frazier/001-paper-magazine-ad.jpg
Campaign for Braddock Hospital (Save Our Community Hospital), 2011, Portfolio mit 12 Prints, Fotolithographien und Siebdruck, 43 x 35,5 © LaToya Ruby Frazier / Michel Rein, Paris/Brussels / KADIST Collection, Paris
LaToya Ruby Frazier
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/19-latoya-ruby-frazier/002-grandma-ruby-and-upmc.jpg
Campaign for Braddock Hospital (Save Our Community Hospital), 2011, Portfolio mit 12 Prints, Fotolithographien und Siebdruck, 43 x 35,5 © LaToya Ruby Frazier / Michel Rein, Paris/Brussels / KADIST Collection, Paris
LaToya Ruby Frazier
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/19-latoya-ruby-frazier/004-healthcare-not-wealthcare.jpg
Campaign for Braddock Hospital (Save Our Community Hospital), 2011, Portfolio mit 12 Prints, Fotolithographien und Siebdruck, 43 x 35,5 © LaToya Ruby Frazier / Michel Rein, Paris/Brussels / KADIST Collection, Paris
LaToya Ruby Frazier
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/19-latoya-ruby-frazier/006-jenny-holzer-s-truism.jpg
Campaign for Braddock Hospital (Save Our Community Hospital), 2011, Portfolio mit 12 Prints, Fotolithographien und Siebdruck, 43 x 35,5 © LaToya Ruby Frazier / Michel Rein, Paris/Brussels / KADIST Collection, Paris
LaToya Ruby Frazier
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0022.gespenstergeschichten.installationsansicht.2017..arno.gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0053_2_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0059_2_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0063_2_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0074_2_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0078_original-schachteln-der-glasplattennegative-sammlung-kunsthalle-mannheim-2017-arno-gisinger.jpg
Original-Schachteln der Glasplattennegative, Sammlung Kunsthalle Mannheim, 2017 © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0080_original-schachteln-der-glasplattennegative-sammlung-kunsthalle-mannheim-2017-arno-gisinger.jpg
Original-Schachteln der Glasplattennegative, Sammlung Kunsthalle Mannheim, 2017 © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0082_original-schachteln-der-glasplattennegative-sammlung-kunsthalle-mannheim-2017-arno-gisinger.jpg
Original-Schachteln der Glasplattennegative, Sammlung Kunsthalle Mannheim, 2017 © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0083_original-schachteln-der-glasplattennegative-sammlung-kunsthalle-mannheim-2017-arno-gisinger.jpg
Original-Schachteln der Glasplattennegative, Sammlung Kunsthalle Mannheim, 2017 © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0086_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0125_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0132_2_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/_0139_2_gespenstergeschichten-installationsansicht-2017-arno-gisinger.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Precher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/06-09-2017_15_01_2015_0015.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Sprecher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/06-09-2017_15_01_2015_0025.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Sprecher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/06-09-2017_15_01_2015_0027.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, Sprecher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck) © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/b0238p-0028_rephotography.jpg
Gespenstergeschichten - Ein Bilderstreit im Mannheimer Wasserturm, Installationsansicht 2017, Ortsspezifische 3 Kanal-Videoprojektion, ca. 15 Min., Ton, (Sprecher: Harald Schröpfer, Ausstellungsarchitektur: Bernhard Tatter, technische Realisation: Martin Beck © Arno Gisinger / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/20-arno-gisinger/pressebild-gisinger-3.jpg
Gespenstergeschichten, Archivblatt der Ausstellung Kulturbolschewistische Bilder (1933), fotografiert in den historischen Ausstellungsräumlichkeiten der Kunsthalle Mannheim während des Umbaus, Farbfotografie 2017 © Arno Gisinger, Kurt Schneyer / Courtesy Arno Gisinger
Arno Gisinger
Kunsthalle Mannheim (Installation im Wasserturm)
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/24-simon-gush/calvin-full-hd_4.jpg
Calvin and Holiday, 2013, HD-Video, Ton © Simon Gush / Courtesy Simon Gush / Stevenson, Cape Town / Johannesburg
Simon Gush
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/24-simon-gush/calvin-full-hd_6_small.jpg
Calvin and Holiday, 2013, HD-Video, Ton © Simon Gush / Courtesy Simon Gush / Stevenson, Cape Town / Johannesburg
Simon Gush
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/24-simon-gush/calvin-full-hd_7_small.jpg
Calvin and Holiday, 2013, HD-Video, Ton © Simon Gush / Courtesy Simon Gush / Stevenson, Cape Town / Johannesburg
Simon Gush
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/24-simon-gush/gush-workers-leaving-2.jpg
Workers Leaving the Factory (Einzelbild), 2014, 19 Dias, Projektion © Simon Gush / Courtesy Simon Gush / Stevenson, Cape Town / Johannesburg
Simon Gush
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/24-simon-gush/gush-workers-leaving.jpg
Workers Leaving the Factory (Einzelbild), 2014, 19 Dias, Projektion © Simon Gush / Courtesy Simon Gush / Stevenson, Cape Town / Johannesburg
Simon Gush
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/coulissen1_2.jpg
Coulissen, 2016, Kabinettfotoalbenseiten, Pappkarton, Kleber, 275 x 39 x 39 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p05.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p23-cmyk.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p25-cmyk.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p27b.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p29-cmyk.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p33-cmyk.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p39-cmyk.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/22-vesko-goesel/p55.jpg
New Photographic Pleasures, 2007-09, 12 Zeichnungen auf Papier, je 30 x 20 cm © Vesko Gösel / Courtesy Vesko Gösel
Vesko Gösel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/30-nikita-kadan/nikita_kadan_slide_from_the_work_limits_of_responsibility_2014_courtesy_campagne_premiere_berlin.jpg
Limits of Responsibility, 2014, 36 Dias, Projektion © Nikita Kadan / Courtesy Nikita Kadan / Campagne Première, Berlin
Nikita Kadan
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/stefan-karrer/stefan_karrer_cool_clouds_videostill_03.jpg
Cool Clouds That Look Like They Should Be Spelling Something, But They Don't, 2016, Video, 8 Min., Ton © Stefan Karrer / Courtesy Stefan Karrer
Stefan Karrer
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-kassem/kassem-006-2.jpg
Badria und Cholud Kassem, Heidelberg, 1959 © Familie Kassem / Courtesy Familie Kassem
Privatarchiv Familie Kassem
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-kassem/wasserturm_kassem_3.jpg
Schaukat und Nasier Kassem, Mannheim, ca. 1965 © Familie Kassem / Courtesy Familie Kassem
Privatarchiv Familie Kassem
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/barbara-kasten/pl10666.jpg
Construct PC 5 C, 1981, Polaroid, 62 x 51 cm, Fotosammlung OstLicht Wien © Barbara Kasten, Fotosammlung OstLicht, Wien
Barbara Kasten
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/barbara-kasten/pl10670.jpg
Construct PC 5 B, 1981, Polaroid, 62 x 51 cm, Fotosammlung OstLicht Wien © Barbara Kasten, Fotosammlung OstLicht, Wien
Barbara Kasten
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/barbara-kasten/pl10671_neu_heller.jpg
Construct PC X, 1982, Polaroid, 62 x 51 cm, Fotosammlung OstLicht Wien © Barbara Kasten, Fotosammlung OstLicht, Wien
Barbara Kasten
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/barbara-kasten/pl10673.jpg
Construct PC XI, 1982, Polaroid, 62 x 51 cm, Fotosammlung OstLicht Wien © Barbara Kasten, Fotosammlung OstLicht, Wien
Barbara Kasten
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/barbara-kasten/pl10686.jpg
Metaphase 4, 1986, Polaroid, 62 x 51 cm, Fotosammlung OstLicht Wien © Barbara Kasten, Fotosammlung OstLicht, Wien
Barbara Kasten
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-keskin/abb_ill_1_rz.jpg
Karneval in Ulm, 1963 © Familie Keskin / Courtesy Familie Keskin
Privatarchiv Familie Keskin
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-keskin/keskin-010a.jpg
Streiten mit Hayri, bei Ulm, 1964 © Familie Keskin / Courtesy Familie Keskin
Privatarchiv Familie Keskin
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-keskin/keskin-010b.jpg
Streiten mit Hayri (Rückseite), bei Ulm, 1964 © Familie Keskin / Courtesy Familie Keskin
Privatarchiv Familie Keskin
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-keskin/keskin-027.jpg
Familie Keskin in Heidelberg, 1966 © Familie Keskin / Courtesy Familie Keskin
Privatarchiv Familie Keskin
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/merle-kroeger/havarie_03_2.jpg
Havarie, 2016, Video, 93 Min., Ton © Merle Kröger und Philip Scheffner, pong film GmbH / Courtesy Merle Kröger und Philip Scheffner
Merle Kröger
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andreas-langfeld/andreaslangfeld-1.jpg
Newsroom-Editeure, 2017, Installation mit dig. C-Prints und Videos © Andreas Langfeld / Courtesy Andreas Langfeld
Andreas Langfeld
C-HUB Kreativwirtschaftszentrum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andreas-langfeld/andreaslangfeld-2.jpg
Newsroom-Editeure, 2017, Installation mit dig. C-Prints und Videos © Andreas Langfeld / Courtesy Andreas Langfeld
Andreas Langfeld
C-HUB Kreativwirtschaftszentrum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/marc-lee/bundestagswahl-meinungskampf-in-den-sozialen-medien-1_small.jpg
Bundestagswahl - Meinungskampf in den sozialen Medien, 2017, Netzwerkbasierter interaktiver Live-Stream © Marc Lee / Courtesy Marc Lee
Marc Lee
Buchhandlung Thalia
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/marc-lee/bundestagswahl-meinungskampf-in-den-sozialen-medien-3.jpg
Bundestagswahl - Meinungskampf in den sozialen Medien, 2017, Netzwerkbasierter interaktiver Live-Stream © Marc Lee / Courtesy Marc Lee
Marc Lee
Buchhandlung Thalia
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/marc-lee/bundestagswahl-meinungskampf-in-den-sozialen-medien-4.jpg
Bundestagswahl - Meinungskampf in den sozialen Medien, 2017, Netzwerkbasierter interaktiver Live-Stream © Marc Lee / Courtesy Marc Lee
Marc Lee
Buchhandlung Thalia
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/marc-lee/bundestagswahl-meinungskampf-in-den-sozialen-medien-6_small.jpg
Bundestagswahl - Meinungskampf in den sozialen Medien, 2017, Netzwerkbasierter interaktiver Live-Stream © Marc Lee / Courtesy Marc Lee
Marc Lee
Buchhandlung Thalia
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21308_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21309_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21310_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21311_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21313_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21314_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21315_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/helmar-lerski/museum-folkwang21317_3.jpg
Verwandlungen durch Licht, 1935/36 (2002), Silbergelatineabzug, 30 x 24 cm, Privatsammlung © Helmar Lerski, Nachlass Helmar Lerski, Museum Folkwang, Essen
Helmar Lerski
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/fred-lonidier/lonidier_f_e.2013.0691-0692-crop-small.jpg
GAF Snapshirts, 1976, Installation, 32 bedruckte T-Shirts, Kleiderbügel © Fred Lonidier / Courtesy Fred Lonidier / Essex Street / New York, Michael Benevento, Los Angeles / SILBERKUPPE, Berlin
Fred Lonidier
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/eva-franco-mattes/018_mattes_dark.jpg
Dark Content, 2015, Installation, Videos, Bürotische, Kabelkorb © Eva & Franco Mattes / Courtesy Caroll/Fletcher, London
Eva & Franco Mattes
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/eva-franco-mattes/abuse-standards-violations-1-side-exhib-carrollfletcher_2_small.jpg
Abuse Standards Violations, 2016, UV-Drucke auf Acrylglas, Isoliermaterial, Abstandshalter, Schrauben, 100 x 100 x 14 cm, 150 x 100 x 8 cm © Eva & Franco Mattes / Courtesy Caroll/Fletcher, London
Eva & Franco Mattes
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/eva-franco-mattes/ceiling-cat-large-8935-_small.jpg
Ceiling Cat, 2016, Katze (Taxidermie), Polyurethanharz, Deckenöffnung © Eva & Franco Mattes / Courtesy Caroll/Fletcher, London
Eva & Franco Mattes
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/rosa-menkman/menkman-still_small.jpg
Dear Mr Compression, 2010, Fehlerhafts .WMV-Video © Rosa Menkman / Courtesy Rosa Menkman
Rosa Menkman
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/01_barch_raf_04-04.201718029-2.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Konspirative Wohnung, Wohnung Spurensicherung, Konspirative Wohnung der ersten Generation RAF, Inheidener Str. 69, Frankfurt a. M., 1972 © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/02_barch_raf_04-04.201718029.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Konspirative Wohnung, Wohnung Spurensicherung, Konspirative Wohnung der ersten Generation RAF, Inheidener Str. 69, Frankfurt a. M., 1972 © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/02_lalb_el-51_3-_negative6400_2.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Zellen Stammheim, Spurensicherung, Zellen Stammheim, nach dem 17.10.1977, Stammheim #07, 1977/2016, Interieur Zelle 716 (Raspe) © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/04_barch_raf_04-04.201718061.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Konspirative Wohnung, Wohnung Spurensicherung, Konspirative Wohnung der ersten Generation RAF, Inheidener Str. 69, Frankfurt a. M., 1972 © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/04_lalb_el-51_3-_negative6493_694.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Zellen Stammheim, Spurensicherung, Zellen Stammheim, nach dem 17.10.1977, Stammheim #31, 1977/2016, Bücherregal I & II Zelle 720 (Ensslin) © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/06_barch_raf_04-04.201718101.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Konspirative Wohnung, Wohnung Spurensicherung, Konspirative Wohnung der ersten Generation RAF, Inheidener Str. 69, Frankfurt a. M., 1972 © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/08_barch_raf_04-04.201718179-2.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Konspirative Wohnung, Wohnung Spurensicherung, Konspirative Wohnung der ersten Generation RAF, Inheidener Str. 69, Frankfurt a. M., 1972 © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/arwed-messmer/09_barch_raf_04-04.201718218.jpg
aus RAF - No Evidence / Kein Beweis, 2017, aus Konspirative Wohnung, Wohnung Spurensicherung, Konspirative Wohnung der ersten Generation RAF, Inheidener Str. 69, Frankfurt a. M., 1972 © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und editierten Negativen / Abzügen
Arwed Messmer
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/naeem-mohaiemen/baf170811_katalog_de_2092.jpg
Live True Life or Die Trying, 2009, 42 C-Prints, je 40 x 50 cm bzw. 20 x 50 cm © Naeem Mohaeiemen / Courtesy Naeem Mohaiemen / Experimenter, Kolkata
Naeem Mohaiemen
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/naeem-mohaiemen/baf170811_katalog_de_209.jpg
Live True Life or Die Trying, 2009, 42 C-Prints, je 40 x 50 cm bzw. 20 x 50 cm © Naeem Mohaeiemen / Courtesy Naeem Mohaiemen / Experimenter, Kolkata
Naeem Mohaiemen
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/zanele-muholi/zm_p_18.jpg
Bakhambile, aus Somnyama Ngonyama (Zulu: Heil der schwarzen Löwin), Parktown, 2016, Silbergelatineabzug, 80 x 60 cm, Privatsammlung, Deutschland © Zanele Muholi / Courtesy Zanele Muholi / Wentrup, Berlin / Stevenson, Cape Town, Johannesburg / Yancey Richardson, New York
Zanele Muholi
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/zanele-muholi/zm_p_19.jpg
Thulie II, aus Somnyama Ngonyama (Zulu: Heil der schwarzen Löwin), mlazi, Durban, 2016, Silbergelatineabzug, 50 x 41 cm, Privatsammlung, Berlin © Zanele Muholi / Courtesy Zanele Muholi / Wentrup, Berlin / Stevenson, Cape Town, Johannesburg / Yancey Richardson, New York
Zanele Muholi
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/zanele-muholi/zm_p_20.jpg
Dudu, aus Somnyama Ngonyama (Zulu: Heil der schwarzen Löwin), Parktown, 2016, Silbergelatineabzug, 70 x 63,8 cm © Zanele Muholi / Courtesy Zanele Muholi / Wentrup, Berlin / Stevenson, Cape Town, Johannesburg / Yancey Richardson, New York
Zanele Muholi
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/zanele-muholi/zm_p_24.jpg
Thando II Nuoro, aus Somnyama Ngonyama (Zulu: Heil der schwarzen Löwin), Sardinia, Italy, 2015, Silbergelatineabzug, 80 x 52,6 cm, Privatsammlung, Deutschland © Zanele Muholi / Courtesy Zanele Muholi / Wentrup, Berlin / Stevenson, Cape Town, Johannesburg / Yancey Richardson, New York
Zanele Muholi
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/oscar-munoz/still-mesa-13_3.jpg
Sedimentaciones, 2011, Videostill, Installation, 40 Min., Tische © Oscar Muñoz / Courtesy Oscar Muñoz / Mor Charpentier, Paris
Oscar Muñoz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/oscar-munoz/still-mesa-16_4.jpg
Sedimentaciones, 2011, Installation, 40 Min., Tische © Oscar Muñoz / Courtesy Oscar Muñoz / mor Charpentier, Paris
Oscar Muñoz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/floris-m-neusuess/floris-m.neusuess-tanz-1965.jpg
Tanz, 1965, Fotogramm, 3-teilig, je 259,4 x 89,5 cm, Courtesy DZ BANK Kunstsammlung © Floris M. Neusüss, DZ BANK Kunstsammlung
Floris M. Neusüss
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/louis-vignes-charles-negre/dsc05481.jpg
aus Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain, 1871-74: Planche 57. Djerash. Bains et vue prise vers le sud, 1864 / 1871-74, Heliogravüre, 19,7 x 26,3 cm, Thomas Walther Collection © Louis Vignes & Charles
Louis Vignes & Charles Nègre
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/louis-vignes-charles-negre/dsc05482.jpg
aus Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain, 1871-74: Planche 57. Djerash. Bains et vue prise vers le sud, 1864 / 1871-74, Albuminabzug, (umkopiert), 22,3 x 28 cm, Thomas Walther Collection © Louis Vignes & Charles
Louis Vignes & Charles Nègre
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/louis-vignes-charles-negre/dsc05483.jpg
aus Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain, 1871-74: Planche 57. Djerash. Bains et vue prise vers le sud, 1864 / 1871-74, Albuminabzug, 19,6 x 26,1 cm, Thomas Walther Collection © Louis Vignes & Charles
Louis Vignes & Charles Nègre
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-panevski/fotobuch-0007.jpg
Fotoalbum von Dushan Panevski, 1961 © Familie Panevski / Courtesy Familie Panevski
Privatarchiv Familie Panevski
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/last-page_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/page1bis-bear_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/page2-bear_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/page3-bear_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten© Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/page5_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/pagina4a-kopie_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/schrotkorn_flucht_2.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/migrant-image-research-group/trypage5-ebenen_01_sc.jpg
Running Through the Desert: Roberto Koch, Direktor der italienischen Bildagentur Contrasto, zeigt der Gruppe das Foto "Sahara desert Libya/Egypt border", 18. Mai 2014 von Giulio Piscitelli, 2017, Multimedia-Installation, bestehend aus Wandzeichnungen einer Landkarte und Photo-Graphic-Novels basierend auf der Reflexion von Meidienildern, aus weiteren Fotografien, Videos und gerahmten Zeichnungen, Audio-Interviews und Gesprächen mit Migranten und Aktivisten, Zeitungscovern, Videomaterial von Frontex-Mitarbeitern und weiteren Dokumenten © Migrant Image Research Group / Courtesy Migrant Image Research Group
Migrant Image Research Group
ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/willem-de-rooij/wdr_001.jpg
Index: Riots, Protest, Mourning and Commemoration (as represented in newspapers, January 2000 - July 2002) 2003, 18 Collagen auf Papier, je 185 x 141 cm, (Bouquet V), 2010, Privatsammlung, Frankfurt am Main © Willem de Rooij
Willem de Rooij
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/willem-de-rooij/wdr_004_2.jpg
Index: Riots, Protest, Mourning and Commemoration (as represented in newspapers, January 2000 - July 2002) 2003, 18 Collagen auf Papier, je 185 x 141 cm, 2010, Privatsammlung, Frankfurt am Main © Willem de Rooij
Willem de Rooij
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/petrel-i-roumagnac-duo/2017_duo_juin_e-escougnou_orthez-2.jpg
Théâtre (theatre) #2 / résidus #1, 2017, (Foto: Edouard Escougnou-Cetraro) © Pétrel I Roumagnac (duo) / Courtesy Pétrel I Roumagnac (duo) / Galerie Escougnou-Cetraro, Paris
Pétrel I Roumagnac (duo)
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/ed-ruscha/2017_07_090_2.jpg
Every Building on the Sunset Strip, 1966, Offsetdruck, Leporello, 18,7 x 14,6 cm, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen © Ed Ruscha
Ed Ruscha
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/ed-ruscha/2017_07_091_2.jpg
Every Building on the Sunset Strip, 1966, Offsetdruck, Leporello, 18,7 x 14,6 cm, Wilhelm-Hack-Museum LudwigshafenEvery Building on the Sunset Strip, 1965, Offsetdruck, Leporello, 18,7 x 14,6 cm, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen © Ed Ruscha
Ed Ruscha
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/d-h-saur/weiss120417_026_2.jpg
Hope 2008-17, Version I, 2017, Collage auf Vliesgewebe, ca 200 x 300 cm © D. H. Saur / Courtesy D. H. Saur
D. H. Saur
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/belit-sag/my-camera-seems-to-recognize-people_stillnr1_2.jpg
my camera seems to recognize people, 2015, 3-Kanal Videoinstallation © belit sağ / Courtesy belit sağ
belit sağ
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/belit-sag/my-camera-seems-to-recognize-people_stillnr2_2.jpg
my camera seems to recognize people, 2015, 3-Kanal Videoinstallation © belit sağ / Courtesy belit sağ
belit sağ
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/belit-sag/my-camera-seems-to-recognize-people_stillnr3_2.jpg
my camera seems to recognize people, 2015, 3-Kanal Videoinstallation © belit sağ / Courtesy belit sağ
belit sağ
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/merle-kroeger-philip-scheffner/havarie_03_2.jpg
Havarie, 2016, Video, 93 Min., Ton © Merle Kröger und Philip Scheffner, pong film GmbH / Courtesy Merle Kröger und Philip Scheffner
Philip Scheffner
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid2.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid3.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid4.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid5.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid6.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid7.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid8.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/joachim-schmid/joachimschmid.jpg
aus Other People's Photographs, 2008-11, 96 Bücher, je 18 x 18 cm, je 36 S. mit 32 Abb. © Joachim Schmid / Courtesy Joachim Schmid / P24 Bologna
Joachim Schmid
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/buky-schwartz/schwartz-12_2.jpg
Video Constructions, Segment 1, 1978, Video auf Monitor, 4:07 Min., Ton, Courtesy The Estate of Buky Schwartz ©The Estate of Buky Schwartz
Buky Schwartz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/buky-schwartz/schwartz-12tif_2.jpg
Video Constructions, Segment 2, 1978, Video auf Monitor, 1:16 Min., Ton, Courtesy The Estate of Buky Schwartz ©The Estate of Buky Schwartz
Buky Schwartz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/buky-schwartz/schwartz_3_2.jpg
Video Constructions, Segment 4, 1978, Video auf Monitor, 3:40 Min., Ton, Courtesy The Estate of Buky Schwartz ©The Estate of Buky Schwartz
Buky Schwartz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/buky-schwartz/schwartz_4_2.jpg
Video Constructions, Segment 5, 1978, Video auf Monitor, 2:46 Min., Ton, Courtesy The Estate of Buky Schwartz ©The Estate of Buky Schwartz
Buky Schwartz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/buky-schwartz/schwartz_5_2.jpg
Video Constructions, Segment 3, 1978, Video auf Monitor, 4:30 Min., Ton, Courtesy The Estate of Buky Schwartz ©The Estate of Buky Schwartz Courtesy The Estate of Buky Schwartz ©The Estate of Buky Schwartz
Buky Schwartz
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-sirma/troskana-028a.jpg
Raci Sirma vor dem Mannheimer Wasserturm, um 1965 © Familie Sirma / Courtesy Familie Sirma
Privatarchiv Familie Sirma
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-sirma/wasserturm_kirst_1.jpg
Raci Sirma vor dem Mannheimer Wasserturm, um 1965 © Familie Sirma / Courtesy Familie Sirma
Privatarchiv Familie Sirma
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/john-smith/49-om-monk_2_small.jpg
Om, 1986, Filmstill, 16 mm Film, 4 Min., Ton © John Smith / Courtesy John Smith / Galerie Tanya Leighton, Berlin
John Smith
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/john-smith/51-om-skinhead_2_small.jpg
Om, 1986, Filmstill, 16 mm Film, 4 Min., Ton © John Smith / Courtesy John Smith / Galerie Tanya Leighton, Berlin
John Smith
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/mark-soo/mark-soo_untitled-madame-guillotine-ver-1.jpg
Madame Guillotine, 2017, Installation, Laser Light Projector, C-Prints, je 92 x 120 cm © Mark Soo / Courtesy Mark Soo
Mark Soo
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_11.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_12.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristenristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_13.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_14.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_16.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_17.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_18.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_19.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_20.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_i_21.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_ii_10.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_ii_7.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_ii_8.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrzej-steinbach/as_figur_ii_9.jpg
aus Figur I, Figur II, 2014/15, Inkjet-Print, 90 x 60 cm © Andrzej Steinbach / Courtesy Andrzej Steinbach / Galerie Conradi Hamburg / Sammlung Gebrüder Kristen
Andrzej Steinbach
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/sebastian-stumpf/standbild_river_02_.jpg
River, 2017 (VideostillI), Videoprojektion, 16:08 Min., Ton, Courtesy Sebastian Stumpf und Galerie Thomas Fischer, Berlin © Sebastian Stumpf
Sebastian Stumpf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/sebastian-stumpf/standbild_treppe_01.jpg
Treppe, 2017, Videoprojektion, Loop © Courtesy Sebastian Stumpf / Galerie Thomas Fischer, Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2017 für Max Bill „Endlose Treppe“
Sebastian Stumpf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/sebastian-stumpf/standbild_treppe_03.jpg
Treppe, 2017, Video, ca. 12 Min., Ton © Courtesy Sebastian Stumpf / Galerie Thomas Fischer, Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2017 für Max BIll „Endlose Treppe“
Sebastian Stumpf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys110315_0193_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 23, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys110315_0222_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 33, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys110315_0400_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 70, Chateau d'Ambleville, 2015, Giclee-Print, 152 x 229 cm © Juergen Teller / Courtesy Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys110315_0446_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 25, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys110315_0661_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 35, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys310315_3673_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 26, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys310315_3692_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 24, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/juergen-teller/sys310315_3761_rgb.jpg
Kanye, Juergen & Kim, No. 34, Chateau d'Ambleville, 2015, System Magazine Supplement, Nr. 5, Paris, 2015 © Juergen Teller
Juergen Teller
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/wolfgang-tillmans/2012-062-sensor-flaws-dead-pixels-eso_3.jpg
sensor flaws & dead pixels, ESO, 2012, Inkjet-Print, 138 x 208 cm © Wolfgang Tillmans / Courtesy Wolfgang Tillmans / Galerie Buchholz, Berlin / Museum Folkwang Essen
Wolfgang Tillmans
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/wolfgang-tillmans/2012-113-named-unnamed-galaxies_2.jpg
named and unnamed galaxies, ESO, 2012, Inkjet-Print, 74,8 x 96,6 cm © Wolfgang Tillmans / Courtesy Wolfgang Tillmans / Galerie Buchholz, Berlin / Museum Folkwang Essen
Wolfgang Tillmans
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/gaston-tissandier/gaston-tissandiers-002_small.jpg
Les Merveilles de la Photographie, 1874, 2 Bücher, je 18,5 x 12 cm, 328 S., Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim / Privatsammlung, Konstanz © Gaston Tissandier
Gaston Tissandier
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/gaston-tissandier/gaston-tissandiers-003_small.jpg
Les Merveilles de la Photographie, 1874, 2 Bücher, je 18,5 x 12 cm, 328 S., Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim / Privatsammlung, Konstanz © Gaston Tissandier
Gaston Tissandier
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/gaston-tissandier/gaston-tissandiers-004_small.jpg
Les Merveilles de la Photographie, 1874, 2 Bücher, je 18,5 x 12 cm, 328 S., Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim / Privatsammlung, Konstanz © Gaston Tissandier
Gaston Tissandier
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/oraib-toukan/oraib-toukan-when-things-occur-1.jpg
When Things Occur, 2016, Video, 28 Min., Ton © Oraib Toukan / Courtesy Oraib Toukan
Oraib Toukan
Heidelberger Kunstverein
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-troncone/trocone-001.jpg
Am Mannheimer Wasserturm, um 1970 © Familie Troncone / Courtesy Familie Trocone
Privatarchiv Familie Troncone
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-troncone/trocone-002.jpg
Am Mannheimer Wasserturm, um 1970 © Familie Troncone / Courtesy Familie Trocone
Privatarchiv Familie Troncone
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/amalia-ulman/ep_01.jpg
Excellences & Perfections, 2014 (Instagram Update, 11th July 2014), C-Print, 125 x 125 cm © Amalia Ulman / Courtesy Amalia Ulman / Arcadia Missa London
Amalia Ulman
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/amalia-ulman/ep_02_2.jpg
Excellences & Perfections, 2014 (Instagram Update, 7th July 2014), C-Print, 125 x 125 cm © Amalia Ulman / Courtesy Amalia Ulman / Arcadia Missa London
Amalia Ulman
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/amalia-ulman/ep_03_2.jpg
Excellences & Perfections, 2014 (Instagram Update, 4th July 2014), (#work #it #bitch), C-Print, 125 x 125 cm © Amalia Ulman / Courtesy Amalia Ulman / Arcadia Missa London
Amalia Ulman
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/hermann-vogel/hermann-vogel-002.jpg
Farbtafel aus Hermann Vogel, Lehrbuch der Photographie. Die photographische Chemie, die photographische Praxis und die photographische Ästhetik, 1874, Buch, 23 x 15,5 cm, 528 S., Privatsammlung Konstanz © Hermann Vogel
Hermann Vogel
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/hajra-waheed/women_shorthair_highres_01.jpg
Women with Short Hair, aus Anouchian Passport Portrait Series, seit 2008, Xylene Transfer und Bleistift auf Papier, Serie à 9 Zeichnungen, je 39 x 23,9 cm © Hajra Waheed / Courtesy Hajra Waheed
Hajra Waheed
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/hajra-waheed/women_shorthair_highres_02.jpg
Women with Short Hair, aus Anouchian Passport Portrait Series, seit 2008, Xylene Transfer und Bleistift auf Papier, Serie à 9 Zeichnungen, je 39 x 23,9 cm © Hajra Waheed / Courtesy Hajra Waheed
Hajra Waheed
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/hajra-waheed/women_shorthair_highres_03.jpg
Women with Short Hair, aus Anouchian Passport Portrait Series, seit 2008, Xylene Transfer und Bleistift auf Papier, Serie à 9 Zeichnungen, je 39 x 23,9 cm © Hajra Waheed / Courtesy Hajra Waheed
Hajra Waheed
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/marianne-wex/2017_07_064_2.jpg
"Weibliche" und "männliche" Körpersprache als Folge patriarchalischer Machtverhältnisse, 1979, Buch, 24 x 30 cm, 377 S., Privatsammlung / Martina Pantke, Maison Forstfeld © Marianne Wex
Marianne Wex
Sammlung Prinzhorn
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/googlestillcomposite.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.38.58-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.40.56-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.43.42-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.46.48-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.47.46-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.49.04-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/screen-shot-2017-07-23-at-11.59.15-am.jpg
Workers Leaving The Googleplex, 2009-11, 7-Kanal Videoinstallation auf Monitoren © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/wilson_poster_the_abc_of_photography-2.jpg
The ABC of Photography - 2, 2014, aus ScanOps, seit 2012, Inkjet-Prints auf selbstklebendem Gewebe, 91 x 61 cm © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/andrew-norman-wilson/wilson_poster_the_inland_printer_edit-164_3.jpg
The Inland Printer - 164, 2012, aus ScanOps, seit 2012, Inkjet-Prints auf selbstklebendem Gewebe, 91 x 61 cm © Andrew Norman Wilson / Courtesy Andrew Norman Wilson
Andrew Norman Wilson
Port25 – Raum für Gegenwartskunst
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/max-wolf/2017_07_009.jpg
Studie über den Sternenzuwachs auf drei fotografischen Platten desselben Himmelsausschnitts bei unterschiedlicher Belichtungszeit, Alpha Cyg, Platte G273, Belichtungszeit: 3h, 7.9.1891, Glasplattennegativ, 18 x 13 cm, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH), Landessternwarte © Max Wolf, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf
Max Wolf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/max-wolf/2017_07_014.jpg
Studie über den Sternenzuwachs auf drei fotografischen Platten desselben Himmelsausschnitts bei unterschiedlicher Belichtungszeit, Alpha Cyg, Platte G304, Belichtungszeit: 13h, 8 Min., 9.9.1891, Glasplattennegativ, 18 x 13 cm, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH), Landessternwarte © Max Wolf, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf
Max Wolf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/max-wolf/2017_07_018.jpg
Studie über den Sternenzuwachs auf drei fotografischen Platten desselben Himmelsausschnitts bei unterschiedlicher Belichtungszeit, Alpha Cyg, Platte G302, Belichtungszeit: 1h, 1.6.1891, Glasplattennegativ, 18 x 13 cm, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH), Landessternwarte © Max Wolf, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf
Max Wolf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/max-wolf/2017_07_026_3.jpg
Max Wolf / Johann Palisa, aus Photografische Sternkarte, 1900-16, Platte B1022, Belichtungszeit: 4h, 10.7.1904, Glasplattennegative, 30 x 24 cm, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH), Landessternwarte © Max Wolf, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf
Max Wolf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/max-wolf/bilder-86967-80611-original__ub-d203_17__48f26c02_2_small.jpg
Bildarchiv GmbH Freiburg im Breisgau, Himmelsaufnahmen Max Wolf (1899-1910), 1922, 10 Silbergelatineabzüge, je 18 x 12 cm, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf (Heid. Hs. 3695) © Max Wolf, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf
Max Wolf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/max-wolf/sternkarten-001_2.jpg
Max Wolf / Johann Palisa, aus Photografische Sternkarte, 1900-16, Blatt Nr. 139, Belichtungszeit: 4h, 10.7.1904, Bromsilbergelatineabzug, 36 x 27,5 cm, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH), Landessternwarte © Max Wolf, Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlass Max Wolf
Max Wolf
Wilhelm-Hack-Museum
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-zippel/18420001.jpg
Brühl, Germaniastraße, um 1973 © Familie Zippel / Courtesy Familie Zippel
Privatarchiv Familie Zippel
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-zippel/18420003_b_rz.jpg
Brühl, Germaniastraße, um 1973 © Familie Zippel / Courtesy Familie Zippel
Privatarchiv Familie Zippel
Kunstverein Ludwigshafen
https://2017.biennalefotografie.de/content/2-edition/2-kuenstler/privatarchiv-familie-zippel/repro_katalog.jpg
Übergangswohnheim in Mannheim-Rheinau, Karl-Peters-Straße (heute Wilhelm-Peters-Straße), um 1965 © Familie Zippel / Courtesy Familie Zippel
Privatarchiv Familie Zippel
Kunstverein Ludwigshafen